Welterbeinnitiative
Lausitzer Tagebaufolgelandschaft
Braunkohle wird in der Lausitz/Łužyca seit mehr als 150 Jahren abgebaut; ein Prozess, der jedoch bis 2038 eingestellt werden soll.
Nun gibt es eine Initiative, die anstrebt, die Lausitzer Tagebaufolgelandschaft langfristig als UNESCO-Welterbe schützen zu lassen.
Die Bewerbung um die Aufnahme auf die deutsche UNESCO-Tentativliste wurde durch die zuständigen Ministerien Ende 2021 an die Kulturministerkonferenz eingereicht.
Aktuell wird die Bewerbung geprüft, während in der Region vertieft am Projekt Welterbe Lausitzer Tagebaufolgelandschaft geforscht wird.
Was macht die Lausitzer Tagebaufolgelandschaft in einem globalen Kontext so außergewöhnlich?
Im Rahmen des Bündnisses „Land-Innovation-Lausitz“ befassten sich zunächst das Verbundvorhaben „LIL-Welterbe“ mit der Thematik (2020/2021), seit September 2022 gibt es das Anschlussprojekt „LIL-SME“. Beide sind durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Förderprogramm „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ gefördert.
Das Verbundvorhaben um die TFL
LIL-Welterbe stellt den Kontext der historischen Entwicklung der Kulturlandschaft des Lausitzer Reviers bis zum heutigen Stand her. Im Rahmen des Braunkohleabbaus hat sich in der Lausitz bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Tradition der Entwicklung innovativer Landnutzungsstrategien entwickelt, auf der die heutige Forschung aufgebaut werden kann. In diesem Kontext verfolgt die „Welterbestudie: Lausitzer Tagebaufolgelandschaften als UNESCO Welterbe“ das Ziel, über den Zeitraum von 18 Monaten, die Welterbefähigkeit
der Lausitzer Tagebaufolgelandschaften abzuwägen.
Das Projekt soll durch internationale Anerkennung einen neuen, positiv behafteten Zugang zur regionalen Geschichte des Braunkohleabbaus und der damit verbundenen Landschaftsinnovation schaffen. Zusätzlich zu einer gesteigerten regionalen Identität ist
auch ein ökonomischer Nutzen der Welterbeinitiative, insbesondere im Bereich des Kulturtourismus, zu erwarten. Im Rahmen des Projektes wird zudem eine Publikation ausgearbeitet und eine Konferenz veranstaltet, die den Wertschöpfungsdiskurs in den Fokus rücken
Das Hauptziel des Verbundvorhabens war die Erarbeitung eines Antrags für die Aufnahme auf die deutsche Tentativliste des UNESCO Welterbes, welcher 2021 eingereicht und anschließend bis 2024 seitens des Bundes geprüft wurde. Hierfür definierte das Institute for Heritage Management GmbH (IHM) basierend auf den Forschungsergebnissen der Verbundpartner die Attribute, die von potentiellem außergewöhnlichem universellem Wert sind und bewertet diese hinsichtlich ihrer Authentizität und Integrität.
Was hat die Welterbeinitiative bisher erreicht?
1. Einreichung eines Tentativantrags durch MWFK und SMR (Oktober 2021)
2. circa 40 Berichte in Printmedien und Fernsehen
3. Konferenz (September 2021) und Publikation (Mai 2022) KULTUR[tagebau]LANDSCHAFT
4. Vorstellung des Projektes auch im
internationalen Kontext
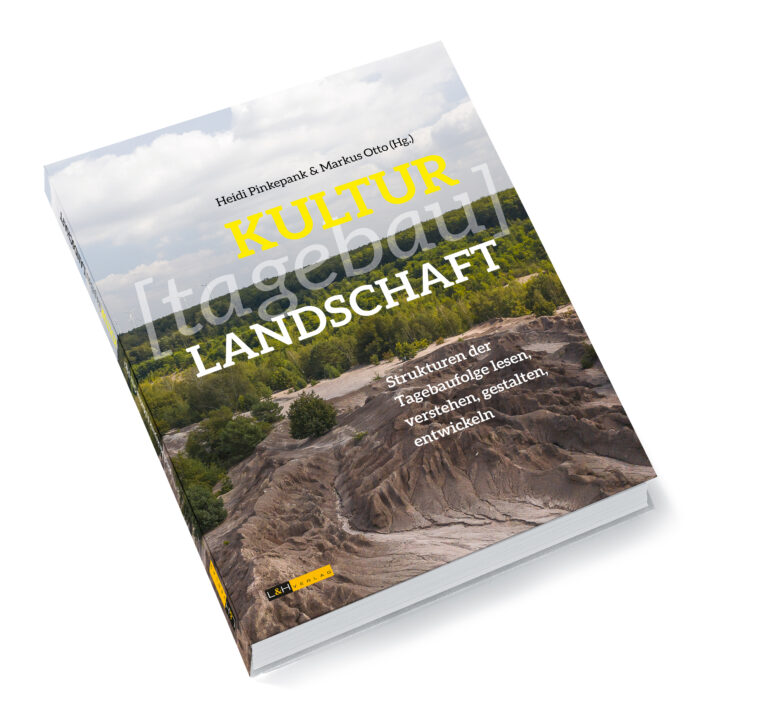
Cover der Publikation KULTUR[tagebau]LANDSCHAFT © L & H Verlag (2022)
Kultur und Natur Welterbe
1.157 UNESCO-Welterbestätten in 167 Ländern weltweit machen die Geschichte der Menschheit und des Planeten erlebbar. 51 von ihnen befinden sich in Deutschland, darunter zehn grenzüberschreitende oder transnationale Stätten. Welterbestätten sind Zeugnisse vergangener Kulturen, materielle Spuren von Begegnungen und Austausch, künstlerische Meisterwerke und einzigartige Naturlandschaften. Ihnen gemeinsam ist ihr außergewöhnlicher universeller Wert, also ihre Bedeutung nicht nur für nationale oder lokale Gemeinschaften, sondern für die gesamte Menschheit.
UNESCO Welterbestätten
Warum Welterbestätte werden? Vorteile und Konsequenzen
Die Einschreibung in die Welterbeliste bedeutet die Anerkennung des außergewöhnlichen universellen Wertes einer Stätte für die gesamte Menschheit und damit auch des sehr hohen Schutzanspruches der jeweiligen Stätte. Schutz, Erhalt und Vermittlung dieser Stätten sind
Sinn und Zweck der Welterbekonvention und Aufgabe aller beteiligten Akteurinnen und Akteure.
Mit der Anerkennung einer Natur- oder Kulturstätte als Welterbe sind keine finanziellen Zuwendungen durch die UNESCO verbunden. Vielmehr verpflichten sich die zuständigen Regierungen, die Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen eigenständig zu finanzieren. In Deutschland kommt aufgrund der Kulturhoheit die Verantwortung für die Sicherstellung von Schutz und Erhalt den Bundesländern zu.
Zu den weiteren Aufgaben der Vertragsstaaten gehört die Vermittlung des Wertes der Welterbestätten sowie des Gedankens der Welterbekonvention an die Öffentlichkeit. Insbesondere soll über die Gefahren für Welterbestätten aufgeklärt werden.

10 UNESCO Kriterien
Die UNESCO gibt 10 Kriterien vor (benannt: i-x), von denen mindestens eines erfüllt sein muss.
Wie soll die Einzigartigkeit vor der UNESCO argumentiert werden?
Kriterien für UNESCO Welterbeinitiative Lausitzer/Łužyca Tagebaulandschaft Welterbevorschlagsgebiet:
(ii): für einen Zeitraum oder in einem Kulturgebiet der Erde einen bedeutenden Schnittpunkt menschlicher Werte in Bezug auf die Entwicklung der Architektur oder Technik, der Monumentalkunst, des Städtebaus oder der Landschaftsgestaltung aufzeigen (Auszug aus der Welterbekonvention)
• illustriert 120 Jahre der Entwicklung von Strategien der großflächigen Gestaltung von ehemaligen Tagebauen und deren Umfeld
• zeigt, wie verschiedene Generationen mit den vielfältigen Veränderungen ihrer Umgebung umgegangen sind
• erklärt, wie die sorbischen Traditionslinien und die Industriekultur sich gegenseitig beeinflusst haben
• Landschaftsgestaltungsansätze dienen in ähnlichenRegionen weltweit als Vorbild
(iv): ein hervorragendes Beispiel eines Typus von Gebäuden, architektonischen oder technologischen Ensembles oder Landschaften darstellen, die einen oder mehrere bedeutsame Abschnitte der Geschichte der Menschheit versinnbildlichen (Auszug aus der Welterbekonvention)
• symbolisiert die Radikalität des Braunkohleabbaus
• beweist den besonderen Innovationsgeist für die Gestaltung der Landschaft nach dem Tagebau
• ist stellvertretend das beste Beispiel für die Landschaften, die weltweit nach dem Tagebau erschaffen wurden
• repräsentiert alle weltweit bekannten Nutzungsstrategien von Tagebaufolgelandschaften der verschiedenen Zeitphasen
Zeitachse
2018 - 2019
Das Verbundvorhaben um die TFL
Text
2018 - 2019
07/2020 - 12/2021
„LIL-Welterbe“
Am 29. Oktober 2020 wurde ein Antrag für die Aufnahme der Lausitzer Tagebaufolgelandschaft auf die deutsche UNESCO Tentativliste bei der Kultusministerkonferenz vom brandenburgischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) in Zusammenarbeit mit dem sächsischen Ministerium für Regionalentwicklung (SMR) eingereicht. Zudem erschien im Mai 2022 die Publikation „KULTUR[tagebau] LANDSCHAFT“ im L&H Verlag, welche sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit dem Phänomen „Tagebaufolgelandschaft“ auseinandersetzt. Der Antrag zur Aufnahme der Lausitzer Tagebaufolgelandschaft auf die UNESCO Tentativliste wurde im Herbst 2023 abgelehnt.
2022 - 2025
„LIL-SME“
Aufbauend auf dem Vorgängerprojekt „LIL-Welterbe“, welches zum Ziel hatte zunächst das Potenzial der Lausitzer Tagebaufolgelandschaft als UNESCO Welterbe zu prüfen und gleichzeitig die technologischen und kulturellen Spezifika der Folgelandschaft zu erforschen (07/2020 – 12/2021), stehen bei „LIL-SME“ nun eine vertiefende Analyse der historischen Leitbilder und der Elemente der Tagebaufolgelandschaft sowie vor allem der Dialog mit der Lausitzer Bevölkerung und damit innovative Vermittlungsformate im Fokus. Des Weiteren sollen von den Verbundpartnern umfassende Management- und Tourismuskonzepte erarbeitet werden, die sowohl Bedarfe des Minderheiten-, Natur- als auch Denkmalschutzes berücksichtigen. So wird der Weg zum potenziellen Welterbestatus in die Strukturwandelprozesse der Region eingebunden. Projektpartner in dem Vorhaben sind neben dem INIK das Institute for Heritage Management (IHM) als Koordinatorin sowie die Brandenburgische-Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) mit dem FG ABWL. insb. Marketing, das Sorbische Institut/Serbski institut (SI) mit seiner neuen Abteilung Regionalentwicklung und Minderheitenschutz und der Tourismusverband Lausitzer Seenland mit Sitz in Senftenberg. Der Projektverbund wird im Rahmen der Initiative „Land-Innovation-Lausitz“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Es handelt sich um eine Förderung im Rahmen des WIR!-Programms („Wandel durch Innovation in der Region“).
2022 - 2025
Beispielhafte Änderung vorher/ nachher
Bitte bewegen Sie den Slider in der Mitte des Bildes nach links oder rechts.



